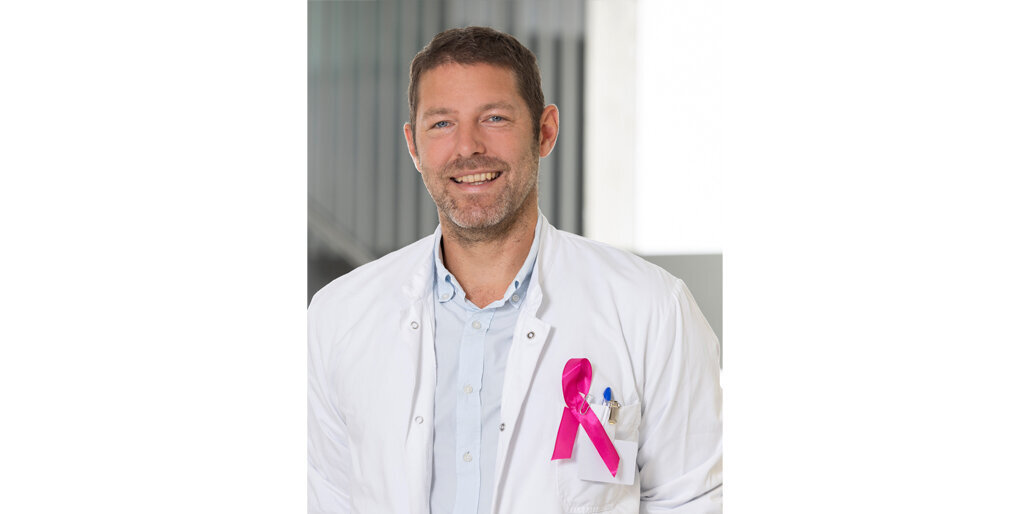Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jede achte Frau ist davon betroffen. Dank Früherkennung und Weiterentwicklung der Therapie hat die Diagnose etwas an Schrecken verloren.
Wie stehen die Chancen auf Heilung?
Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Aussichten auf Heilung. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen. In Österreich wird beispielsweise ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm angeboten: Frauen ab dem 45. Lebensjahr haben die Möglichkeit, regelmäßig eine Mammografie durchführen zu lassen. „Besteht eine familiäre Vorbelastung, etwa durch bereits aufgetretene Mammakarzinome, können Frauen ab dem 40. Lebensjahr daran teilnehmen“, erklärt Oberarzt Dr. Stefan Uranitsch, Leiter des Brustgesundheitszentrum in der Klinik Güssing.
Wie erfolgen Diagnose und Therapie im Brustgesundheitszentrum?
Ein Brustgesundheitszentrum ist eine spezialisierte Einrichtung, in der Expert*innen verschiedener Fachrichtungen eng zusammenarbeiten, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Patient*innen – auch Männer können von Brustkrebs betroffen sein – werden in der Regel von niedergelassenen Ärzt*innen – meist Radiolog*innen – mit einer Verdachtsdiagnose, etwa aufgrund einer auffälligen Mammografie, überwiesen. Im Zentrum erfolgt eine umfassende Abklärung des Befunds. Zunächst wird die auffällige Stelle in der radiologischen Abteilung nochmals untersucht, häufig mit Ultraschall. Je nach Ergebnis können weitere diagnostische Maßnahmen wie eine Biopsie, eine Computertomografie oder eine MR-Mammografie notwendig werden.
Alle erforderlichen Untersuchungen und Behandlungsschritte finden unter einem Dach statt. Für die Patient*innen bedeutet das: kurze Wege, klare Abläufe und ein/e zentrale/r Ansprechpartner*in. Das interdisziplinäre Team begleitet und betreut Sie während des gesamten Prozesses – gemeinsam und koordiniert.
Informationsflut im Internet – wie finden Patient*innen verlässliche Antworten?
Die Fülle an Informationen im Internet kann überwältigend sein – und leider sind nicht alle Inhalte korrekt oder hilfreich. Die Suche über "Dr. Google" führt oft zu Verunsicherung, vor allem dann, wenn unpassende Schlagwörter eingegeben werden. Statt Klarheit zu schaffen, erzeugen viele Online-Quellen eher Angst.
„Verlässliche, geprüfte Informationen finden Sie auf den Webseiten der Brustgesundheitszentren oder bei der Krebshilfe“, betont der Experte. „Noch besser ist der persönliche Kontakt: Wenn Sie ein Brustgesundheitszentrum – sei es bei uns oder anderswo in Österreich – aufsuchen, erhalten Sie individuelle Betreuung durch ein erfahrenes Team. Darüber hinaus stehen Ihnen auch Psychologinnen und Psychologen zur Seite, um Sie emotional zu unterstützen. Mein Tipp: Schreiben Sie alle Fragen auf, die Ihnen im Kopf herumgehen – ganz gleich, wie unwichtig sie Ihnen erscheinen. Jede Frage ist berechtigt und verdient eine ehrliche, verständliche Antwort“, so Uranitsch weiter.
Wie wird entschieden, welche Behandlung notwendig ist?
Jeder einzelne Fall wird im sogenannten Tumorboard besprochen – einer interdisziplinären Besprechung, an der Expert*innen aus Radiologie, Onkologie, Chirurgie und Gynäkologie teilnehmen. Gemeinsam analysiert das Team alle Befunde und legt die individuell bestmögliche Therapie fest.
Die Wahl der Behandlung hängt maßgeblich vom Tumortyp ab, denn Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Tumoren können sehr unterschiedliche biologische Eigenschaften aufweisen. Eine wichtige Rolle spielen dabei sogenannte Oberflächenrezeptoren, die Hinweise auf das Ansprechen auf bestimmte Therapien geben. In manchen Fällen ist es sinnvoll, zunächst eine Chemotherapie durchzuführen, bevor operiert und anschließend bestrahlt wird.
Ziel ist immer eine individuell zugeschnittene Therapie – abgestimmt auf die Art des Tumors, das Stadium der Erkrankung und die persönliche Situation der Patientin.
Staging als wichtiger Schritt
Nach der Erstdiagnose wird bei allen Patient*innen ein sogenanntes Staging durchgeführt. Dabei wird mittels CT und weiterer Untersuchungen – etwa der Knochen – geprüft, ob der Krebs bereits gestreut hat. Das ist wichtig, da Brustkrebs häufig in die Knochen metastasiert.
Wenn es sich um einen lokal begrenzten Tumor handelt, der operativ gut entfernt werden kann, bestehen sehr gute Heilungs-Chancen. Brustkrebs ist in der Regel gut behandelbar – insbesondere dann, wenn er frühzeitig erkannt wird und noch keine Metastasen gebildet hat.
Entscheidend für den langfristigen Behandlungserfolg ist außerdem die Nachsorge: Denn das Risiko für ein Rezidiv – also ein Wiederauftreten des Tumors – kann über einen Zeitraum von zehn Jahren erhöht sein. Wie hoch dieses Risiko ist, hängt stark vom jeweiligen Tumortyp ab.
Lebenswichtige Nachsorge
Gesundheitszentren begleiten ihre Patient*innen in der Regel über einen Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren nach der Behandlung. Diese kontinuierliche Betreuung ist besonders wichtig, um bei auftretenden Fragen oder Beschwerden – zum Beispiel Nebenwirkungen der antihormonellen Therapien, wie Hitzewallungen oder Knochenschmerzen – schnell reagieren zu können. Für viele dieser Nebenwirkungen gibt es wirksame Behandlungsmöglichkeiten.
Die onkologische Therapie verbessert sich ständig, und auch die chirurgischen Eingriffe werden immer schonender. „Während früher bei großen Tumoren häufig die komplette Brust entfernt wurde, ermöglicht die moderne Vortherapie heute eine deutliche Tumorverkleinerung. Dadurch ist ein Brusterhalt in 60 bis 80 Prozent der Fälle möglich“, freut sich Oberarzt Dr. Uranitsch.
Mit optimaler Nachbehandlung kann die Brust erhalten bleiben. Gleichzeitig haben sich auch die Operationstechniken und Möglichkeiten zum Ersatz von Brustdrüsengewebe deutlich weiterentwickelt. Für Patient*innen mit genetisch erhöhtem Risiko besteht zudem die Möglichkeit, die Brustdrüse vorsorglich zu entfernen und diese entweder durch Eigengewebe oder Silikonimplantate kosmetisch ansprechend zu rekonstruieren – mit minimalen optischen Einbußen.
Fortschritte bei Therapien
Die medizinische Forschung – insbesondere in der Onkologie – entwickelt sich rasant. In den vergangenen Jahren wurden bedeutende Fortschritte erzielt, sowohl in der medikamentösen Behandlung als auch in der Strahlentherapie.
Ein Beispiel aus der medikamentösen Therapie ist der Einsatz von CDK4/6-Inhibitoren. Diese zielgerichteten Medikamente werden insbesondere bei hormonrezeptor-positivem (HR+) Brustkrebs eingesetzt – vor allem in fortgeschrittenen oder metastasierten Stadien – und haben die Behandlungsmöglichkeiten deutlich verbessert.
„Auch in der Strahlentherapie hat sich viel getan. Während früher oft sechs bis acht Wochen lang bestrahlt wurde, kommt heute zunehmend die sogenannte Hypofraktionierung zum Einsatz“, so der Experte. Dabei wird die Bestrahlung auf zwei bis drei Wochen verkürzt – bei gleichbleibender Wirksamkeit und sogar besseren Ergebnissen hinsichtlich der Verträglichkeit und Überlebensraten.
Zum Einsatz kommen auch Immuntherapien. Sie sind, ähnlich wie Chemotherapien, additive Therapien, die ergänzend im Rahmen einer onkologischen Therapie eingesetzt werden.
Erbliche Belastung und Prävention
Studien zeigen: Rund ein Viertel aller Brustkrebserkrankungen wäre durch einen gesünderen Lebensstil vermeidbar. Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol und Rauchen lassen sich aktiv beeinflussen. Besonders hilfreich sind regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, Ausdauersport wie Walking oder Joggen sowie eine ausgewogene Ernährung.
Nicht beeinflussbar sind genetische Veränderungen, etwa Mutationen der sogenannten BRCA-Gene. Liegt eine solche Mutation vor, besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. In diesen Fällen sind vorsorgliche (prophylaktische) Maßnahmen möglich – etwa engmaschige Kontrollen oder präventive Operationen –, die auch von der Krankenkasse übernommen werden.
Wann ist eine genetische Beratung sinnvoll?
„Eine genetische Abklärung wird empfohlen, wenn in der Familie mehrere Fälle von Brustkrebs auftreten – insbesondere, wenn eine Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr festgestellt wurde“, weiß der Senologe. Da Brustkrebs in so jungen Jahren sehr selten ist (Durchschnittsalter liegt bei etwa 65 Jahren), kann das auf eine erbliche Belastung hinweisen. In solchen Fällen wird im Brustgesundheitszentrum zunächst der Tumor getestet. Zeigt sich dabei eine hohe genetische Auffälligkeit, kann auch ein Gentest für betroffene Familienangehörige erfolgen.
Wie sinnvoll ist die Selbstuntersuchung der Brust?
Selbstuntersuchungen sind ein wichtiger Teil der Früherkennung. Idealerweise sollte man die Brust ein- bis zweimal pro Woche abtasten. Interessanterweise werden kleine Tumoren unter einem Zentimeter häufig von Patient*innen selbst ertastet – noch bevor sie bei gynäkologischen Untersuchungen auffallen. Wer seine Brust regelmäßig abtastet, lernt Veränderungen früh zu erkennen.
Hormonersatztherapien in unterschiedlicher Form
Hormonersatztherapien hatten lange Zeit einen schlechten Ruf. Moderne Hormonersatztherapien – etwa zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden – können heute auch in lokaler Form angewendet werden, etwa als Cremes oder Vaginalzäpfchen. „Bei hormonrezeptor-positivem Brustkrebs raten wir in der Regel von einer klassischen Hormonersatztherapie ab, da diese das Rückfallrisiko erhöhen kann“, erklärt der Leiter des Brustgesundheitszentrums in der Klinik Güssing. Es gibt jedoch auch nicht-hormonelle Alternativen, die zur Behandlung von Symptomen der Wechseljahre eingesetzt werden können. Diese gelten als unbedenklich und können auch bei entsprechender Indikation weiterhin verwendet werden.
Rasante Weiterentwicklung bei Brustkrebstherapien
Insbesondere in der Chemotherapie wurden große Fortschritte erzielt. Immer häufiger kommt es zu sogenannten pathologischen Komplettremissionen – das bedeutet, dass der Tumor unter der präoperativen Therapie so stark zurückgeht, dass er nach der Behandlung nicht mehr nachweisbar ist. In vielen Fällen müssen dann nur noch abgestorbene Tumorzellen entfernt werden.
Ein großer Vorteil dieser Entwicklung zeigt sich auch im Axillarmanagement – also der Behandlung der Lymphknoten in der Achselregion. „Lymphknoten sind entscheidend für die weitere Therapieplanung, da sie oft von Tumorzellen befallen sind“, so der Experte. Dank moderner Chemotherapien werden Tumorzellen und befallene Lymphknoten häufig so weit zurückgedrängt, dass sie selbst unter dem Mikroskop (histologisch) nicht mehr sichtbar sind.
Derzeit ist die Entfernung des sogenannten Wächterlymphknotens (Sentinel-Lymphknotens) noch der Goldstandard. Doch durch die schnellen Fortschritte in der Chemotherapie könnte sich dieses Vorgehen zukünftig verändern. Wächterlymphknoten sind wichtig für die Entscheidung über Bestrahlung und weitere Therapien.
Früher wurden bei Brustkrebs oft alle Lymphknoten in der Achsel entfernt, heute reicht es meist aus, nur ein bis zwei Sentinel-Lymphknoten zu entnehmen. Dieses schonendere Verfahren verbessert die Lebensqualität der Patient*innen erheblich, da das Risiko für Komplikationen wie Lymphödeme – unangenehme Schwellungen in der Hand und im Arm – deutlich reduziert wird.